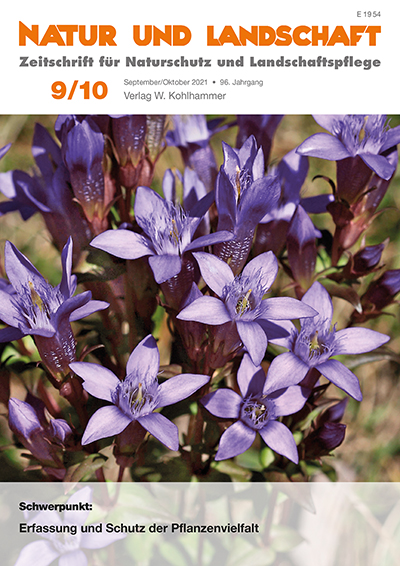
Lesen Sie im Abonnentenbereich weiter oder erwerben Sie die Ausgabe in unserem Shop
Mit einem Online-Abo können Sie die Gesamte Ausgabe als PDF ansehen oder herunterladen
In unserem Web-Shop können Sie unsere Zeitschrift erwerben
Die floristische Kartierung in Deutschland – Methoden, Ergebnisse, Herausforderungen und Chancen ● Floristic mapping in Germany – Methods, results, challenges and opportunities
Gefäßpflanzen im bundesweiten Naturschutz-Monitoring ● Vascular plants in the nationwide nature conservation monitoring system
Feldbotanikzertifizierung in der Schweiz, Österreich und Südwestdeutschland ● Certificates for field botany in Switzerland, Austria and south-western Germany
Genetische Grundlagen für den botanischen Artenschutz in Deutschland ● The genetic basis for plant conservation in Germany
Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft – Sicherung in genetischen Erhaltungsgebieten ● Crop wild relatives for food and agriculture – Conservation in genetic reserves
Gefährdete Pflanzen erhalten – Wiederansiedlungen als Artenschutzmaßnahme ● Preserving endangered plant species – Reintroductions as a conservation measure
Informationskampagne „Lokal, regional – ganz egal?! – Herkunft von Naturschutzsaatgut für Garten, Park und Landschaft“