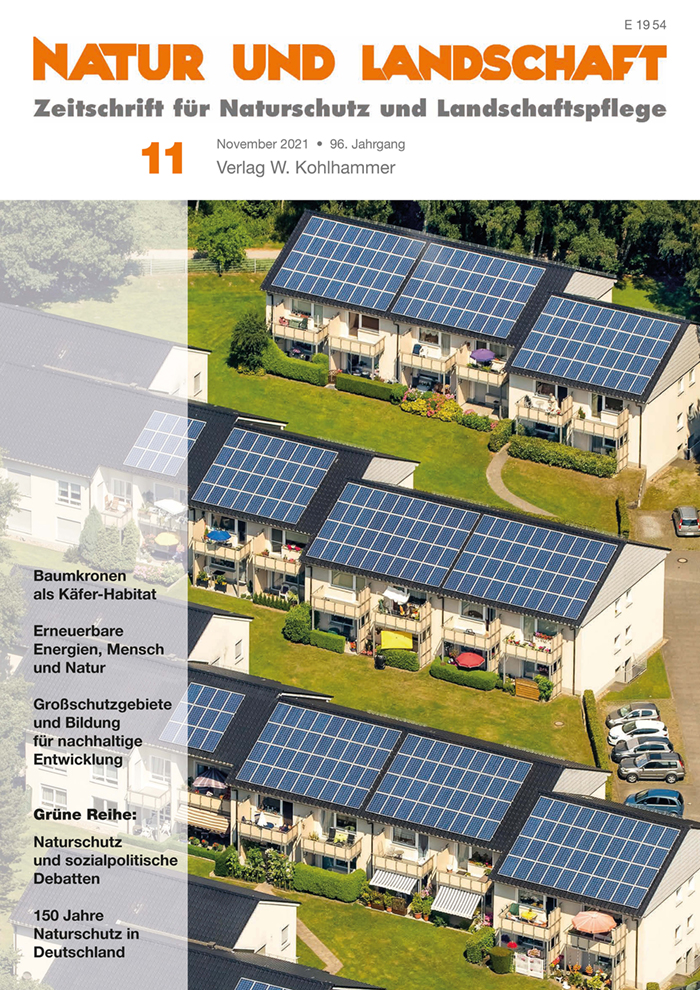
Lesen Sie im Abonnentenbereich weiter oder erwerben Sie die Ausgabe in unserem Shop
Mit einem Online-Abo können Sie die Gesamte Ausgabe als PDF ansehen oder herunterladen
In unserem Web-Shop können Sie unsere Zeitschrift erwerben
Baumkronen als Habitat gefährdeter Käfer am Beispiel von Hartholzauwäldern in Sachsen-Anhalt, Region Mittelelbe ● Tree crowns as habitat of endangered beetles as exemplified by alluvial hardwood forests in Saxony-Anhalt, Middle Elbe Reserve
100 % erneuerbare Energien in Deutschland: Kann der Energiebedarf 2050 im Einklang mit Mensch und Natur gedeckt werden? ● 100% renewable energy in Germany: Can energy demand in 2050 be met in a way that is compatible with people and nature?
Historie und Aktualität der Beziehungen zwischen Naturfragen und sozialen Fragen – ein Plädoyer für ein stärkeres Engagement des Naturschutzes in sozialpolitischen Debatten ● History and present features of the relationship between nature issues and social issues – A plea for stronger engagement of nature conservation in socio-political debates
Schwerpunkt Windenergie